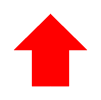 Zum Anfang der Seite
Zum Anfang der SeiteHier lesen Sie weitere Angaben zu den Bauteilen, deren Platzierung und können auch die Zeichnung zu dem Kühlblech sicherlich besser verstehen. Auch sollte man eine bestimmte Reihenfolge der Bestückung beachten die wir hier beschreiben. Lassen Sie sich nicht vom Bestückungsplan abschrecken: die eingezeichneten Gehäuse sind an einige Stellen größer gezeichnet als die realen Abmessungen. Tatsächlich überdecken sich die Bauteile nicht gegenseitig.
Bevor man sich jedoch einfach die Bauteile laut Stückliste bestellt, sollte man überlegen, zu welchem Zweck man die Karte einsetzen will. Je nach Anwendung kann man einige Teile sparen und die Beschaffung vereinfachen.
Zuerst ist die Frage nach dem maximalen Strom zu beantworten. Der Spannungsregler IC10 bestimmt diesen Wert. Ein LM317T regelt bei ca. 1,5 Ampere ab, ein LM350T erst bei 3 Ampere. Da die IC's immer noch eine gewisse Streuung haben, muss man bei letzterem Typ mit einem Spitzenstrom von 4 Ampere rechnen. Diesen Wert muss die Stromversorgung liefern können. Darüber hinaus müssen die Verbindungsleitungen der Busplatine, die Dioden D17 - 32 und auch die zur Anlage führenden Kabel diesen Strom vertragen. Eigentlich sollte der "kleinere Bruder" mit seinen 1,5A meist ausreichen. Bedenken Sie bitte, dass bei Anwendung dieser Karte für die 4 Gleise einer Richtung in einem Bahnhof immer nur höchstens zwei Züge gleichzeitig fahren können.
Bei der schwächeren Variante kann man ein paar Cent sparen wenn man statt der Dioden 1N5401 die Typen 1N4001 wählt. Das Risiko eines Defektes steigt jedoch bei einem über längere Zeit unentdeckten Kurzschlusses.
Bei einem Schattenbahnhof wird man auch meist mit weniger als den 4 möglichen Abschnitten auskommen: ein Brems- und ein Haltabschnitt reichen dort fast immer. Bei dieser Einschränkung kann man etwas an den Bauteilen und der Verkabelung sparen.
Wenn der Fahrabschnitt 1 entfällt, kann man folgende
Bauteile weglassen:
Dioden 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 4, 8, 12 und
16
Widerstände 14, 18, 22 und 26
Kondensatoren 35, 39, 43, 47, 19, 23, 27 und 31
Für den Fahrabschnitt 2 gilt:
Dioden 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 3, 7, 11 und
15
Widerstände 13, 17, 21 und 25
Kondensatoren 34, 38, 42, 46, 18, 22, 26 und 30
Die hier verwandten Stiftleisten haben ein Rastermaß von nur 3,5 mm. Die gängigen Bauformen haben einen Abstand von Stift zu Stift von 5 mm und wären damit zu breit für die Karte. Man kann sie bei Beschaffungsschwierigkeiten verwenden wenn man auf die Frontblende verzichtet und den Trimmer R2 "fliegend verdrahtet" an eine andere Stelle setzt. Weiterhin muss man dann die kleinen Dioden 1N4001 in die enger beieinander liegenden Löcher einlöten. Wer keine steckbare Verbindungen braucht, kann auch Mini- Anschlussklemmen einlöten.
Das Bestücken beginnt man, wie üblich, mit den niedrigsten Teilen: die 48 Dioden 1N4148 und die verschiedenen Widerstände kommen als erstes an die Reihe. Dann folgen die IC-Fassungen, die 100nF-Kondensatoren, die Widerstandsnetzwerke und so weiter. Die kleinen Transistoren sollten so tief wie möglich eingesetzt werden, sonst gibt es Schwierigkeiten mit den Schrauben der FET's. Diese Transistoren T5 bis 8 sowie IC10 werden jedoch noch nicht eingelötet.
Die Kondensatoren C17 bis C31 sollen Miniaturtypen sein. Sie sollen nämlich unter dem Blech Platz finden. Wären sie höher, müsste die Kühlfläche kleiner werden oder die Bauhöhe würde zunehmen.
Auch die beiden Elkos C52 und C53 sind etwas kritisch. Sie dürfen einen Durchmesser von 12 mm und eine Höhe von 15mm nicht überschreiten. Wegen der Platzverhältnisse ist auch ihr Wert gegenüber den Hersteller-Applikationen verringert. Wer mechanisch kleinere Typen mit 470myF findet oder die Spannungsstabilisierung zu anderen Zwecken aufbaut, sollte ruhig auf insgesamt 1000myF oder mehr kommen. Man muss aber auch auf die Spannungs- festigkeit achten: sie sollte mindestens das zweifache der unbelasteten Wechselspannung vor dem Gleichrichter betragen.
Im Bestückungsplan sind der Übersichtlichkeit wegen 4 Brücken nicht eingezeichnet. Neben den Transistoren findet man größere Lötaugen die von 1 bis 4 nummeriert sind. Diese sind mit einem Stückchen Litze mit ca. 0,3mm2 Querschnitt mit den Dioden an den Ausgängen zu verbinden. Deren Kathoden sind in Vierergruppen zusammengefasst und ebenfalls mit Ziffern versehen.
Der Kühlkörper ist nach der Zeichnung anzufertigen. Es sollte 1,5 mm dick und wegen der Wärmeleitung aus Aluminium oder aus Kupfer sein. Fixieren Sie einen Ausdruck der heruntergeladenen Zeichnung auf dem Alublech, körnen die Löcher an und bohren Sie dann. Die äußeren Abmessungen sind weniger kritisch als die Lage der Löcher zueinander. Nach der Metallbearbeitung kann man mit der Montage der Halbleiter beginnen. Der Bestückungsplan ist der Übersicht wegen so gezeichnet, als ob die Teile stehend montiert würden. Tatsächlich müssen sie jedoch so abgewinkelt werden, dass ihre metallische Rückseite nach oben zeigt. Bei IC10 ist das einfach, es wird direkt auf das Kühlblech geschraubt. Wärmeleitpaste verbessert die Abfuhr der Wärme, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Die 4 Transistoren müssen isoliert montiert werden. Man kann sich Isolierbuchsen und elektrisch isolierende Wärmeleitfolie besorgen. Aus der Folie schneidet man ein Stück für die 4 Halbleiter zu. Auch mit den Montagesätzen, die man für TO220-Gehäuse bekommt, kann man arbeiten. In jedem Falle sollte man sich die Teile genau ansehen bevor man zu bohren beginnt und gegebenen- falls die Lochdurchmesser den Isolierteilen und den Schrauben anpassen.
Nach der Montage der Halbleiter biegt man die Beinchen um. Diese sollte man nicht einfach abknicken, sondern einen Draht von etwa 1mm zu Hilfe nehmen und so einen gewissen Biegeradius sicherstellen. Auf diese Weise verringert man die Gefahr, dass die Anschlüsse abbrechen wenn man die Einheit einmal zerlegen muss.
Optimisten bestücken dann die IC's und löten die Transistoren und IC10 ein. Andere Zeitgenossen testen zunächst den Aufbau noch ohne den Kühlkörper. Sie ersparen sich eine mühselige Demontage und noch schlimmer die erneute Montage mit bereits eingelöteten Halbleitern im Falle einer Fehlfunktion der darunter liegenden Bauteile.
Der Test erfolgt mit dem gleichen Programm, mit dem man auch schon die 2-fach-Karte auf ihre Funktion hin geprüft hat. Man muss nur die 4-fach-Karte als zwei 2-fach-Exemplare betrachten und entsprechende Eintragungen machen. Beim Stecken der Adressbrücken ist zu beachten, dass das niederstwertige Bit fehlt und daher nur eine gerade Adresse einstellbar ist. Die Karte belegt dann auch die nächst höhere Adresse wie wir es in ähnlicher Form bei der Weichenkarte schon gesehen hatten. Ist alles richtig eingestellt müssen sich die Gleisbesetztmelder melden wenn man einen Ausgang mit Masse verbindet.
Die Funktion eines Fahrreglers kann man zunächst am Pin 5 des 74HC85 testen: bei Fahrstufe 0 ist auch dort die Spannung annähernd 0Volt. Mit jeder höheren Stufe steigt sie bis auf fast 5Volt an. Ob die kleinen BC547 den Lötvorgang überlebt haben, lässt sich wegen des noch fehlenden Spannungsstabilisators und damit der stabilisierten Versorgungsspannung nur mit einer "Krücke" feststellen. Entweder man schließt einfach die Leitung +5V (z. B. Pin 16 von IC6) an den Anschluss für den mittleren Pin von IC10 an. Das ist nämlich der Ausgang, im Schaltplan als "OUT" bezeichnet. Die zweite Möglichkeit ist das Verbinden von Ein- und Ausgangsanschluss wenn die Stromversorgung der Fahr- spannung nicht mehr als 25Volt abliefert. Der Eingang ist das in Richtung Trimmer liegende Lötauge. Am Knoten T3/T5/R10 muss sich bei verschiedenen Fahrstufen eine unterschiedliche Spannung ergeben. Dieser Testpunkt ist die breite Leiterbahn auf der Bestückungsseite die die 3 Bauteile miteinander verbindet. Sie sieht auch bei den 3 anderen Baugruppen genauso aus und ist daher leicht zu finden. Bei diesem Test ist die Spannung umso höher je niedriger die Stufe eingestellt wird, sie verhält sich also genau umgekehrt als im ersten Schritt.
Übrigens konnte man mit etwas Phantasie aus den vorhergehenden Zeilen auch ableiten, wo an einem LM317T oder seinem Kollegen LM350T was anzuschließen ist. Wenn man das Teil so vor sich legt, dass man die Beschriftung lesen kann, ist links der Anschluss "ADJ" und rechts der Eingang "IN". Der mittlere Anschluss, der übrigens mit dem Gehäuse verbunden ist, muss dann logischerweise der Ausgang sein.
Wenn der erste Test keine Mängel zeigte, kann der letzte Montageschritt erfolgen. Das Kühlblech wird von den Bauteilen und zwei Schrauben mit je drei Muttern gehalten. Bei einem Rastermaß der Busplatine von 20mm dürfen die Schrauben insgesamt nicht länger als 19mm lang sein. Meist muss man also die Standardgröße kürzen. Hierzu noch ein Tipp: drehen Sie vor dem Abfeilen eine Mutter auf. Dreht man sie später über den Gewindeanschnitt wird dieser eher gängig.
Das Einfädeln der 15 Beinchen erfordert allerdings etwas Geduld, sollte aber bei sauberer Ausrichtung der Bauteile und ihrer Anschlüsse in jedem Fall gelingen. Spätestens jetzt schraubt man die gekürzten Schrauben in die Platine und fixiert mit zwei weiteren Muttern den Kühlkörper in der richtigen Lage. Wenn man sicher ist, nichts vergessen zu haben, lötet man die Transistoren und IC10 fest.
Dann folgen die letzten Testschritte: funktioniert der Spannungs- stabilisator? Mit dem Multimeter zwischen Masse und dem Aus- gang, z. B. an dem Alublech, sollte man die mit R2 einstellbare Spannung messen können. Bei Belastung innerhalb der Grenzwerte sollte sie sich nicht wesentlich ändern. Auch sollte man einmal ausprobieren, ob die Strombegrenzung funktioniert. Als abschließende Prüfung misst man mit einer Last die Ausgangsspannung an den zum Gleis führenden Anschlüssen. Sie muss sich gemäß den Fahrstufen verändern lassen.
Perfektionisten werden auch eine Frontblende montieren wollen. Dazu besorgt man sich am besten die vorgefertigten Bleche im Handel und ein Kunststoffteil, das Platine und Blende verbindet. Nach dem Übertragen der Zeichnung auf das Werkstück wird's kompliziert. Während die Bohrungen noch einfach anzubringen sind, wird man bei den rechteckigen Durchbrüchen um Sägen und Feilen kaum herumkommen. Machen sie sich nichts daraus, wenn ihr erster Versuch keinen Schönheitspreis gewinnen kann. Der Hobby-Werker muss sich nicht schämen wenn es mal einen breiteren Spalt oder ein Langloch statt eines runden Lochs gibt.