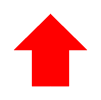 Zum Anfang der Seite
Zum Anfang der SeiteWenn man einen Schattenbahnhof mit vielen Gleisen betreiben will braucht man pro Gleis einen Fahrregler und damit je nach Modellbahn eine hohe Anzahl Fahrreglerkarten. Die nachfolgend beschriebene Karte bedient bis zu vier Gleise und halbiert damit die Anzahl Karten gegenüber dem 2-fach-Fahrregler. Durch ein geändertes Schaltungskonzept kann in manchen Fällen noch mehr Platz gespart werden: durch die geringere Bauhöhe ist es vielfach möglich, die Karten dichter in die Busplatine einzustecken.
Es ist natürlich auch hier wie anderswo: alles hat seine Vor- und Nachteile. Um Bauteile und damit Platz zu sparen, wurde die Spannungsstabilisierung und Strombegrenzung nicht einzeln für jedes Gleis aufgebaut. Bei der ersten Karte lieferte jeder der zwei Fahrregler auf einer Karte einen Maximalstrom von z. B. 1,5A (je nach Bestückung). Die neue Karte liefert insgesamt nur 1,5A oder 3A je nach Bestückung. Daher ist sie nicht unbedingt gleichwertig einzusetzen. Allerdings sollte man bedenken, dass in einem Schattenbahnhof immer höchstens 2 Züge gleichzeitig fahren können. Dies bedeutet, dass die Karte ohne Einschränkungen immer dann einsetzbar ist, wenn die Züge weniger als 0,75A (bzw. 1,5A) benötigen. Aber auch beim Überschreiten der Grenzwerte geht nichts kaputt, nur die Spannung wird nicht den nominellen Wert erreichen, die Züge also etwas langsamer fahren.
Die Schaltung dieser Karte ist natürlich umfangreich und beinhaltet viele Bauteile. Daher ist es nicht sinnvoll, den Gesamt- schaltplan zu zeigen. Stattdessen sehen sie ein Blockschaltbild, das heißt die einzelnen Funktionsblöcke der Schaltung. Diejenigen, die sich bereits mit dem System beschäftigt haben, erkennen die Gemeinsamkeiten zu allen anderen Komponenten.
Zunächst beginnen wir mit dem Adreßdecoder. In IC1, einem 74HC688, wird die mit den Steckbrücken festgelegte Adresse der Karte mit der am Bus anliegenden Adresse verglichen. Da 4 Fahrregler 2 Adressen belegen, werden zunächst nur die sieben höchstwertigen Bits der Adresse ausgewertet. Wenn eine der beiden "heißen" Adreß-Kombinationen anliegt, gibt der Baustein an seinem Pin 19 ein Signal ab. Er legt dann den Ausgang auf logisch "0". Die Nicht-Oder-Gatter und die Inverter in IC4 bzw. 5 sind dann so mit dem niederstwertigen Adressbit und IC1 verschaltet, dass man an Pin 4 von IC5b (AdressLow) logisch "0" hat wenn die untere Adresse anliegt, analog geht Pin 2 von IC5a (AdressHigh) auf "0" wenn die obere Adresse angesprochen wird. Mit den restlichen 2 Gattern aus IC4 werden diese beiden Signale so mit der "/Write"- Leitung verknüpft, dass Schreibbefehle zu einer positiven Flanke, das heißt dem Ansteigen des Pegels, an den Ausgängen 1 (IC4a) für die untere Adresse bzw. 13 (IC4d) für die obere führen. Damit werden die Zwischen- speicher der Datenbits für die Fahrregler gesteuert.
Diese Zwischenspeicher sind nur zwei bereits mehrfach benutzte 74HC273. Sie "merken" sich die je 8 Datenbits für die insgesamt 4 Fahrregler.
Wie oben schon angesprochen, musste die Schaltung gegenüber der Zweifach-Fahrreglerkarte vereinfacht werden um Bauteile und damit Platz zu sparen. Daher stabilisiert ein Baustein die Fahrspannung für alle Ausgänge gemeinsam, er begrenzt auch den Strom im Kurzschlussfall. Das bedeutet, dass wenn auf einem Gleis ein Unfall geschieht und die Fahrspannung kurzgeschlossen ist, dann können auch auf den drei übrigen Gleisen der betroffenen Karte keine Züge mehr fahren. Leider ist der unerwünschte Betriebszustand wegen des Bauteile-sparenden Schaltungskonzepts nicht an einer Leuchtdiode zu erkennen.
IC10, ein LM317T für 1,5A oder ein LM350T für 3A Maximalstrom, erfüllt die gerade beschriebenen Aufgaben. Trotz nur drei Anschlüssen und wenigen externen Bauteilen kann man damit eine stabilisierte Gleichspannung zwischen 1,2 und ca. 35Volt erreichen. Die Kondensatoren dämpfen die Schwingneigung der Schaltung, die Widerstände R1 und R2 bestimmen die Spannung. Der Widerstand R27 ist eigentlich nur eine Art "Lebensversicherung" für die Endstufen und kann u. U. entfallen. Was es damit auf sich hat, lesen Sie gleich. Mit dem Trimmer R2 können Sie also jede Spannung zwischen 1,2 und ca. 18Volt einstellen.
Übrigens ist dieser Schaltungsteil eine auch ausserhalb der Steuerung vielfach anwendbare Sache. Zum Dimmen einer Beleuchtung, für einen Elektromotor oder ähnliche Zwecke braucht man doch oft eine einstellbare Spannungsquelle. Dieses IC ist ideal für solche Anwendungen. Es ist fast "unkaputtbar", soll heißen bei richtiger Beschaltung und maximal 35Volt Eingangsspannung kann man es praktisch nicht zerstören. Falls es ihm zu warm wird, stellt es nur langsam die Arbeit ein, d. h. es regelt die Ausgangsspannung herab. Dieser Moment ist aber erst bei ca. 150° C erreicht. Testen Sie bitte seine Temperatur nicht mit den Fingern! Lange bevor es den Dienst einstellt würden sie sich schmerzhafte Brandblasen zuziehen.
Die Fahrstufenvergleicher in den IC's 74HC85 kennen Sie vielleicht noch. Sie geben ein Signal ab wenn der eingestellte Fahrstufenwert größer ist als der Wert des Taktsignals. Falls ein Fahrregler auf die Stufe 0 programmiert ist, wird Pin 5 also nie logisch "1", bei der Stufe 15 ist das immerhin 15/16 der Zeit gegeben. Der nachgeschaltete Transistor wandelt den Pegel um. Seine Stromverstärkung ist hier übrigens unerheblich, es darf also ein A-, B- oder C-Typ sein. Wenn kein Fahrstrom fließen darf, das heißt Pin 5 des IC's liegt auf 0Volt, öffnet T3 und sein Kollektor führt das Potential der eingestellten Fahrspannung. Dann ist auch der Endtransistor geöffnet. Dieser Transistor ist ein so genannter Feldeffekt-Transistor, kurz FET genannt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er keinen Strom zur Ansteuerung verlangt sondern nur eine Spannung. Dadurch kann man ihn, praktisch ohne Leistung aufzubringen, in den leitenden Zustand bringen. Der Wirkungsgrad ist aber auch deshalb so gut, weil der FET nur einen Einschaltwiderstand von ca. 0,3Ohm hat und daher fast keine Leistung aufnehmen muss. Der Transistor leitet wenn man sein Gate auf mindestens -4Volt gegenüber dem Source-Anschluß bringt (der Source-Anschluß ist hier an die stabilisierte Fahrspannung angeschlossen). Es dürfen auch -10 sein, mehr als -20Volt verzeiht er aber nicht und verabschiedet sich unwiderruflich aus dem Leben. Deshalb verhindert R27 in der Spannungsstabilisierung dass man die Ausgangsspannung von IC10 auf mehr als ca. 18Volt einstellen kann. Da dieser Wert für alle Modellbahnen ausreichen sollte, kann man die Ansteuerung der FET's sehr einfach halten.
Die kleinen 1nF-Kondensatoren an der Basis der Transistoren sollen verhindern, dass die Schaltflanken zu steil sind und Störungen verursachen.
Die einzelnen Endstufen sind, genau wie in der früheren Schaltung, über Dioden mit den Gleisbesetztmeldern verbunden. Auch der Rest der Besetztmeldung wird dem Eingeweihten bekannt vorkommen. Zum Schutz der Eingänge der beiden IC's dienen die Widerstände R11 bis 26, die Dioden D33 bis 64 und die Kondensatoren C32 bis 47. Die jeweils 8 Widerstände in RN2 bzw. 4 (jeweils 4,7kOhm) legen einen Pol der Gleise an +5Volt. Das bedeutet eine logische "1" an den Eingängen von IC11 bzw 12. Steht nun ein Stromverbraucher, der einen Widerstand von max. 1,5kOhm hat, auf den Schienen, so heißt dies logisch "0" für den integrierten Schaltkreis. Sein Innenleben besteht aus 8 Invertern. Wenn also unser Gleis besetzt ist, geht der zugehörige Ausgang des Inverters auf "1" und lädt über die Diode den 2,2µF-Kondensator auf. Dieser wird nur langsam über 470kOhm-Widerstände entladen und hält so den Besetzt- Zustand für ca. 0,5 Sekunden auch nach Aufhebung der Belegung aufrecht.
Das Ausgangssignal der Gleisbesetztmelder darf natürlich nur an den Bus angelegt werden, wenn die betreffende Adresse angesprochen ist (Signal Adress-High oder -Low geht nach "0", siehe oben) und vom Bus gelesen werden soll, d. h. das Signal "/Read" logisch "0" ist. Das Lese-Signal wird in den Gattern e und d in IC5 nur zweifach invertiert, also logisch nicht verändert. Der Gleisbesetzt-Zustand, repräsentiert durch den Ladungszustand der 2,2µF-Kondensatoren, wird von den beiden IC's 13 und 14 im passenden Moment an den Bus geschaltet. Praktischerweise haben sie zwei so genannte Freigabe-Eingänge. An den einen legen wir also "/Read" an, an den anderen "Adress-Low" bzw. "Adress-High". So aktivieren wir sie nur wenn beide Leitungen "Low" sind.
Die Schaltung ist sehr umfangreich und erfordert, will man sie komplett durchschauen, schon ein wenig "Denkakrobatik". Man muss sich auch die einzelnen Bilder im Zusammenhang vorstellen, dann gelingt es dem Interessierten sicherlich.
Wie eingangs schon erwähnt, ist das Unterbringen vieler Bauteile auf der begrenzten Fläche einer Euro-Karte nicht ganz einfach. Auch ist das Ableiten der Wärme von IC10 und auch der Endtransistoren bei der gewünschten niedrigen Bauhöhe nur zu lösen, wenn man sich ein spezielles Kühlblech herstellt. Daher stellt der Aufbau der Schaltung etwas höhere Anforderungen. Trotzdem ist es gelungen, ohne exotische Teile auszukommen. In der Bauanleitung erfahren Sie alles über den Aufbau der Karte. Mit den Bildern der Zwischenstände, Zeichnungen des Kühlblechs und einer möglichen Frontblende werden Sie sich sicherlich Klarheit über den Aufbau verschaffen können.